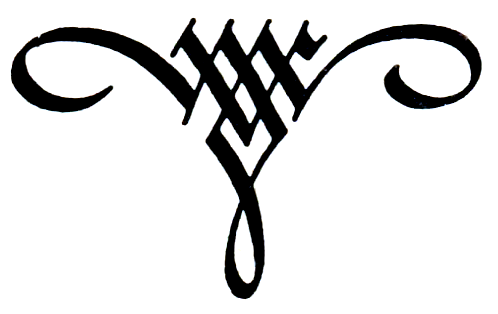Sie waren mir schon in anderen Ländern über den Weg gelaufen, doch in dieser verschlafenen mongolischen Kleinstadt fielen sie besonders auf. Irgendwie erinnerten sie an Pinguine, so fremd und deplatziert wirkten sie mit ihrem schwarzen Schlips, der das weiße Hemd korrekt zusammenhält und dem immer ordentlichen schwarzen Anzug neben den übrigen Leuten. Und sie reden stets höflich und halblaut und lächeln dabei. Sie sind immer nett, obwohl sie doch bei der Missionierung so wenig Erfolg haben in diesem Land.
Wer gäbe ihnen eigentlich das Recht, fragte ich sie, andere von ihrem Glauben abzubringen?
- Gott gibt uns das Recht, behaupteten sie und lächelten.
- Vielleicht haben die andern auch ihr Recht von Gott, konterte ich.
- Wir machen bessere Menschen aus ihnen, behaupteten sie.
- Das Argument kenne ich schon aus der Südsee, aus Papua-Neuguinea, sagte ich. Da haben die Missionare auch behauptet, bessere Menschen aus der Taufe zu heben, doch in Wirklichkeit ging es um Kokosplantagen und Regenwaldabholzung, um Thunfischfang und Goldabbau. Armut und Abhängigkeit kamen gleichzeitig und statt besserer Menschen entwickelten sich Säufer und Diebe.
- Es geht nicht um Geschäfte, es geht um den wahren Glauben.
So redeten wir hin und her und es führte, wie sich jeder denken kann, zu nichts. Auf der Straße war es eisig kalt und windig. Zudem stand Weihnachten vor der Tür. So lud ich die beiden zum Tee ein. Ich bin immer so inkonsequent. Obwohl ich gegen Missionierung bin, taten mir die Missionare leid.
- Gut. Sagte ich, unterhalten wir uns über den Glauben.
Ich erinnerte mich, wie mir einmal zwei Zeugen Jehovas vor ein paar Jahren in Papua-Neuguinea eifrig erklärten, dass ihre Religion die heilige Dreieinigkeit ablehne, weil es im Himmel nur den Vater und den Sohn gäbe und dass ich keine Sorgen zu haben bräuchte, falls ich nicht unter den vierzehntausend sein sollte, die laut Verkündigung nur in den Himmel eingehen, da am jüngsten Tag die ganze Erde in ein Paradies verwandelt würde. Und auch vor der Hölle bräuchte ich mich nicht zu fürchten, weil es die nämlich gar nicht gäbe und ob ich ihnen nicht meine Adresse geben wolle, sie würden mir dann noch viel mehr interessante Informationen schicken. Die beiden waren voll naivem Sendungsbewusstsein und ehrlich von dem, was sie zu sagen hatten, überzeugt. Nur mit ihrem „Wachturm“ sollten sie mich verschonen, bat ich sie.
Ein anderes Mal, wieder in Papua-Neuguinea, stand ich in der Stadt Lae an einem Sonntag an der Haltestelle der Kleinbusse, um ein Auto nach Madang, der Stadt, wo ich lebte, zu erwischen. Das ist sonntags nicht so einfach und ich wartete mehrere Stunden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren zwei Kirchen und ich hatte das seltene Vergnügen, zwei Gottesdiensten gleichzeitig zuhören zu können. Aus dem hohen Gebäude der Pentalcost Church tönten langgezogenen Choräle, aus der kleinen Kirche der Heilsarmee Jesus-Mitklatschlieder. Und ich stellte mir vor, wie Gott in diesem Moment die Gesänge aus hunderttausend verschiedenen Kirchen gleichzeitig hörte und mir tat schon bei dem bloßen Gedanken der Kopf weh. Ich bin eben doch nur ein Mensch.
Ein paar Jahre zuvor, in Uganda, hatte ich jeden Sonntagmorgen die gleiche Diskussion mit dem Hausmeister meines Apartments. Er war ein lieber Afrikaner um die Vierzig, der mit seiner Familie Hof und Grundstück betreute. Und jeden Sonntagmorgen, wenn ich es mir mit einem Buch im Liegestuhl auf der Terrasse bequem gemacht hatte, kam er, um mich zu fragen, ob ich ihn nicht zum sonntäglichen Gottesdienst begleiten wolle. Immer lehnte ich ab und immer fragte er wieder mit der gleichen freundlichen Hartnäckigkeit, mit der ich ablehnte.
Dann, eines Sonntags, antwortete ich ihm:
Ich will dir sagen, warum ich nicht mit zu deinem Gottesdienst komme. Sieh mal, Gott ist doch alles um uns herum, nicht? Der Himmel, die Wiese, die Bäume, die Vögel. Er nickte eifrig. Gott ist alles um uns her, fuhr ich fort, aber jeder Mensch kann nur einen kleinen Teil von Gott sehen, weil er eben nur ein Mensch ist. Und ich formte aus Zeigefinger und Daumen einen Ring und hielt ihn mir vor ein Auge. Der eine sieht zum Himmel und sagt: Gott ist der blaue Himmel. Und ein anderer blickt auf die Erde und sagt: Gott ist das grüne Gras. Und ein anderer blickt auf die Bäume und sagt: Gott ist der hohe Baum. Die Leute haben alle Recht und doch Unrecht. Denn Gott ist zwar Himmel und Gras und Bäume, aber gleichzeitig noch viel mehr. So denkt jeder Mensch sich Gott anders und alle haben damit ein bisschen Unrecht. Vor allem aber kann kein Mensch behaupten, er wüsste, was Gott ist. Kein Mensch kann das, denn wie könnte ein Mensch denn Gott verstehen? Dann müsste er ja selbst wie Gott sein. Auch jede Kirche macht sich ein anderes Bild von Gott und hat damit ebenso ein bisschen Recht wie Unrecht. Und ich mache mir eben auch mein Bild von Gott und habe damit genauso ein bisschen Recht und Unrecht wie dein Pfarrer in der Kirche. Und deshalb bleibe ich bei meinem eigenen Bild von Gott und mag mir nicht anhören, was dein Pfarrer zu sagen hat.
Der Afrikaner sah mich eine Weile schweigend an, aber dann ging ein Strahlen über sein Gesicht, er reichte mir beide Hände und drückte meine Hand lange und sagte: Du hast sehr schön von unserem Gott und der Welt gesprochen. Jetzt verstehe ich dich.
Eines Sonntagnachmittags in einer Pizzeria in Suva, auf den Fidschi-Inseln. Ich hatte gerade bestellt, als ein Mann an meinen Tisch trat, ein Ausländer um die sechzig, doch wirkte er in Jeans und knallbuntem Hemd ein bisschen wie ein Teenager. Auffallend war sein ruhiger Gesichtsausdruck, über dem ein leises Lächeln schwebte. Nach einigen belanglosen Sätzen erzählte er, dass er auf einer der äußeren Inseln in einer Sektengemeinschaft lebe. Und er erzählte von Wunderheilungen ihres Gurus, von gemeinsamen Andachten, dem Leben und Arbeiten für die Gemeinschaft und wie glücklich er wäre. Es wäre ein Amerikaner, der Guru, der viele Jahre in Indien gelebt habe. So, wie er erzählte, war ihre Religion offenbar ein Verschnitt von Katholizismus, Buddhismus und Hare Krishna. Gut, auch ich hatte mich schon mit den verschiedensten Religionen beschäftigt und las regelmäßig in der Bibel, doch nun versuchte auch dieser Mann, mir unbedingt zu beweisen, warum nur seine Sekte der einzig richtige Weg für die Menschheit wäre. Und er stellte mir die Frage:
- Was denkst du über dein Leben, ist es gut oder ist es schlecht?
Wahrscheinlich war es eine Schlüsselfrage für ihn und sein Guru hatte darauf eine weise Antwort parat.
Ich schaute mich im Raum um. Neben unserem Tisch stand ein Kübel mit einer großen Zimmerpflanze. Ich deutete auf ein Blatt und fragte zurück:
- Was denkst du über dieses Blatt? Ist es gut oder ist es schlecht? Überlege! Es gibt nur eine richtige Antwort.
Er grübelte eine Weile und gab dann auf.
- Was ist die richtige Antwort, fragte er neugierig.
- Das Blatt ist – grün. Sagte ich. Es ist nicht gut oder schlecht. Es ist einfach grün, weiter nichts. Und genauso ist mein Leben, setzte ich fort. Es IST einfach. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach mein Leben.
Das ist es, warum ich gegen Missionierung bin.
Doch wie ich meinen beiden Missionaren den Tee in die Schalen goss und in ihre ahnungslosen Kindergesichter schaute, wusste ich, dass ihr Denken erst durch die Jahre mehrmals umgepflügt werden müsste, eh es aufnahmebereit für die Geschichten des Lebens ist. So erzählte ich ihnen nur den Witz eines längst verstorbenen Komikers, der Goldfisch und Kanarienvogel vertauscht hatte und dann feststellen musste, dass der Goldfisch im Käfig immer von der Stange rutschte und der Kanarienvogel im Aquarium ersoff.
Und ich dachte: Warum versuchen Missionare immer wieder, die Fische aufs Land zu ziehen? Warum lassen wir sie nicht einfach alle wo sie hingehören: die Vögel auf dem Baum und die Fische im Wasser. Und die Pinguine? Sollen sie doch in der Antarktis bleiben oder in Salt Lake City oder wo auch immer sie hergekommen sind.
(Heino Hertel - 2002)