Jede Nacht erwache ich schweißgebadet und sehe den Körper reglos im Pool treiben, das Gesicht im Wasser, die weite Bluse auf der Wasseroberfläche ausgebreitet wie zwei bunte Flügel. Die letzten Strahlen der Nachmittagssonne erhellen die Szene wie ein Scheinwerfer. Totenstille.
In mir ist auch Totenstille. Ich will die Stille, nicht diesen Besuch heute! Ich will keinen Besuch, nicht einmal von Sibylle, meiner einstigen Jugendliebe. Doch sie hat mich in mehreren Anrufen so lange genervt, bis ich zusagte. In einer Stunde wird sie vor der Tür stehen und eine Stunde später hoffentlich wieder gehen. Dann hat sie ihren Willen gehabt und ich in Zukunft meine Ruhe.
Nachdem ich mich vor wenigen Wochen auf dieser Südseeinsel unglücklicherweise nicht zum Selbstmord entschließen konnte und später glücklicherweise das Land gerade noch rechtzeitig verließ, bevor mich der Mob lynchen konnte, muss ich nun irgendwie mit mir und meinem gewonnenen Leben zurechtkommen. Aber das erweist sich als Teufelskreis, oder sollte ich besser sagen: Hexenkreis? Denn ich habe es mit Hexerei zu tun und genau das kann ich keinem normalen Menschen erklären, auch nicht Sibylle. Keine Ahnung, woher sie erfahren hat, dass ich wieder in Deutschland bin. Sie meinte, es wäre Intuition gewesen, als sie bei meinen Eltern anrief und sich nach mir erkundigte. Da war ich gerade am Vortag angekommen. Sie hatte noch nie bei meinen Eltern angerufen. Nicht ein einziges Mal, nicht einmal früher, als wir eng befreundet waren.
Worüber werden wir reden? Über meine Erlebnisse im Ausland? Auf keinen Fall! Sollte ich ihr von meinen Albträumen erzählen? Ich könnte höchstens etwas banales Zeug über die Korallenstrände und die Palmen und den Regenwald und die Dörfer in der Südsee berichten, wenngleich das für den gemeinen Mitteleuropäer bereits genug Exotik bedeutet. Der Rest geht sie nichts an. Andererseits, sie war damals auch zu mir gekommen, als sie nicht weiter wusste nach dem Tod ihres Mannes. Oder zuvor, als sie ihn, kaum 19-jährig, geheiratet hatte, er sich zum Alkoholiker entwickelte und sie sich eingestehen musste, dass die ganze Ehe nur in einer Katastrophe enden konnte. Aber das alles lag ewig zurück.
Ich bin längst nicht mehr in sie verliebt. Nein. Das hatte sich endgültig bei unserem letzten Treffen erledigt, was schon wieder zehn Jahre zurücklag. Zwar wäre damals die Gelegenheit für einen Neubeginn gewesen, da ihr Ehemann sich im Vollrausch totgefahren hatte, doch ich kam mir schäbig vor, die Situation auszunutzen. Zudem spürte ich deutlich, dass sie mich nicht liebte, sondern nur allein und unglücklich war.
Ich erinnere mich genau, wie ich Sibylle zum ersten Mal auf dem Schulhof gesehen hatte. Ich war in der Abiturklasse, während sie als Schülerin der neunten Klasse neu an die Schule kam. Sie hatte mich vom ersten Moment an interessiert. Sie war anders als die übrigen Mädchen ihrer Klasse. Sie war zurückhaltend, fast schüchtern, aber hatte dennoch eine sichere Gelassenheit, als könne ihr keiner etwas anhaben. Später stellte ich fest, dass sie niemals gehänselt oder verspottet wurde. Dabei verhielt sie sich durchaus linkisch. Ihre Art zu gehen hatte immer etwas Zögerliches. Es sah stets so aus, als setze sie zu einem großen Schritt an, den sie dann in der Hälfte der Bewegung vermindern wollte. Sie bewegte sich nie locker und unbefangen.
Die Erinnerung an sie macht mich noch unruhiger. Ich beginne im Zimmer auf und ab zu laufen wie ein Tiger im Käfig.
So schlecht ist der Vergleich gar nicht, kommt mir in den Kopf. Ich bin wirklich gefangen wie in einem Käfig. Ich kann hier in Deutschland nicht wieder in die Realität kommen. Ich trotte durch die Straßen wie einst unter den Palmen und sehe kaum, was ich im Supermarkt einkaufe.
Zwar bin ich aus Papua-Neuguinea weggelaufen, bevor sie mich erschlagen konnten, doch wie sollte ich vor mir selbst davonlaufen? Dem Problem wie ein normaler gebildeter Mitteleuropäer beizukommen, hatte ich schon vergeblich versucht. Bereits im Flieger nach Deutschland war mir klar, dass ich mit meinen Erlebnissen ein Fall für die Couch war, sogar ein schwerwiegender. Ich hatte es mit zwei Psychiatern versucht. Ergebnis: Der eine schlug vor, mich für drei Wochen in die Klapse einzuweisen und der andere verschrieb mir ein Kilo Scheiß-egal-Pillen zur Ruhigstellung. Sie wollten mich nur los sein.
Mein bester Freund, dem ich das Ganze zu erzählen begann, bot mir zwar Unmengen Obstler an, klagte aber dann nur über die Schwierigkeit, eine preiswerte Ski-Ausrüstung für den Winterurlaub zu besorgen.
Meine Eltern hatten andere Sorgen. Sie bauten eine neue Ölheizung in ihrem Haus ein und redeten nur von Heizungen und Rechnungen. Mein Bruder war mit seinem eigenen Hausbau beschäftigt und schlug sich mit Handwerkern und der Bauaufsichtsbehörde herum. Dabei hatte ich gerade bei meiner Familie auf Verständnis gehofft. Mussten sie nicht auch etwas von diesen Fähigkeiten geerbt haben?
Seitdem ich hier angekommen bin, lebe ich wie im Nebel und weiß vor allem nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Mir ist die Flucht gelungen. Ich habe in einer Kleinstadt eine leidliche Wohnung im obersten Stock eines leidlichen Hauses mieten können, von wo aus ich einen leidlichen Blick über die Dächer der Stadt habe. Ich bin nicht krank. Ich bekomme für das nächste Jahr etwas Arbeitslosengeld. Niemand schreibt mir Briefe oder Mails, niemand wechselt auf der Straße ein Wort mit mir und erst recht klingelt niemand an meiner Tür. Es ahnt niemand etwas von meinen besonderen Fähigkeiten und den Gefahren, die von mir ausgehen. Ich meinerseits hüte mich, in irgendeiner Weise aufzufallen, und gehe allen Menschen aus dem Weg.
Ich muss zuerst mit mir selbst zurechtkommen. Aber ein Mord lässt sich nicht so einfach ad acta legen. Eigentlich geht es sogar um drei Tote. Oder sollte ich die ersten beiden Fälle als „fahrlässige Tötung“ bezeichnen? Ich muss endlich alles im hintersten Winkel des Gedächtnisses verschließen und einen klaren Schlussstrich ziehen.
Es will mir nicht gelingen. Statt meine verdammten Fähigkeiten zu vergessen, musste ich sie wieder und wieder anwenden. Ohne gezielte Beeinflussung hätte ich nicht einmal diese Wohnung erhalten. Gut, ich gebe zu, dass ich einst meinen Spaß damit hatte. Es gab mir Befriedigung und Bestätigung und eine Zeitlang wollte ich sogar die Welt verändern. Doch dann kam der jähe Absturz in die Verzweiflung. In den Nächten träume ich oft, dass ich falle und falle aber ich wache stets auf, bevor ich sehe, wo ich aufschlage.
Bald wird Sibylle meine Grübeleien unterbrechen.
Noch ist eine Stunde Zeit, bis wir verabredet sind. Ich gieße mir nach kurzem Zögern einen dreistöckigen Whisky ein und setze mich in den Sessel vor das breite, bodentiefe Fenster. Mein Lieblingsplatz. Wobei es ohnehin nicht viele Plätze in meiner Wohnung gibt. Es ist nur ein einziges, dafür sehr großes Zimmer, was zuvor zwei Anwälten als Büro gedient hatte. Als Wohnung schwer vermietbar. Es gibt nicht einmal ein Schlafzimmer, lediglich ein Bad ist abgeteilt. Mir dagegen gefällt das riesengroße Zimmer mit dem breiten, bis zum Boden reichenden Fenster. Es lässt viel Licht in den Raum und vor allem bietet es einen weiten Blick über die Dächer der Stadt. Bis Sibylle kommt, ist Zeit genug, nicht nur den Whisky, sondern auch den langsam dunkler werdenden Himmel zu genießen und die Ereignisse des letzten Jahres noch einmal zu sortieren.
Sie hatten mich gewarnt. Es waren ihre Freundinnen, die mir sagten, dass Nora eine Hexe wäre. Und ich hatte es, wie jeder normale Mensch, mit einem Schulterzucken abgetan. Eine Hexe, na schön, erwiderte ich, welche Frau ist das nicht? Die beiden, die wie jene, von der die Rede war, die Malklasse der Frau meines Chefs besuchten, lächelten nicht, sondern wiederholten nur ernsthaft ihre Warnung. Sie sei eine Hexe, eine wirkliche Hexe. Ihre ganze Familie bestehe aus Hexen. Das wäre allen bekannt. Deshalb müsse man mit ihr vorsichtig sein. Ich solle mich von ihrem bescheidenen, zurückhaltenden Wesen nicht täuschen lassen und sie mir besser aus dem Kopf schlagen.
Auch wenn ich ihnen damals kein Wort glaubte, hatte mich die Ernsthaftigkeit dieser Warnung verblüfft. Zudem kam sie nicht etwa von irgendwelchen alten Leuten in einem der Urwalddörfer, sondern von intelligenten, jungen Frauen, von Künstlerinnen, die in der Hauptstadt lebten und alles andere als rückständig waren.
Zugegeben, ich war damals nicht in Deutschland, sondern in Papua-Neuguinea am anderen Ende der Welt, wo Zauberei und Geisterglauben zum Alltag der Menschen gehörte. Auch hatte ich bereits zwei Jahre an der Nordküste des Landes gearbeitet, hatte viele, zum Teil entlegene Dörfer durch die Projektarbeit besucht. Dort spielten vor allem die verstorbenen Vorfahren eine wichtige Rolle. Ich lernte bald, dass sie keineswegs als tot galten, sondern nach wie vor geachtet und gefürchtet wurden. Auch wenn die Leute es nicht an die große Glocke hängten, ich wusste, dass sie sich vor Entscheidungen stets mit ihren Ahnen berieten und die Geister des Regenwaldes befragten. Ich hatte mir diesen Glauben sogar manchmal zu Nutze gemacht, indem ich darauf hinwies, dass sie nicht das Gebiet ihrer Vorfahren durch Abholzung zerstören dürften.
In anderen Teilen des Landes glaubte man an Sanguma-Menschen, die nachts als magische Tiere Unheil trieben. An der Küste wurden die großen Nashornvögel gefürchtet, weil sie angeblich häufig verwandelte Menschen seien oder deren Geister. Wenngleich die Anwendung von Zauberei offiziell verboten und der größte Teil der Bevölkerung dem Christentum beigetreten war, so spielte der traditionelle Glauben dennoch eine wichtige Rolle.
Doch hier hatte ich es mit etwas anderem zu tun. Hier war nicht von traditionellem Glauben oder den Geistern Verstorbener die Rede, sondern ausdrücklich von einer Hexe. So hatte ich denn die Warnung der beiden Frauen keineswegs ernst genommen.
Zudem war zu diesem Zeitpunkt rein gar nichts geschehen zwischen Nora und mir. Doch selbst das Wissen um die Konsequenzen hätte mich nicht davon abgehalten, mich weiter Nora zu nähern. Vermutlich hätte es zusätzlich meine Neugier geweckt und mich in meinem Entschluss bestärkt.
Es hatte es ganz harmlos angefangen. Mein Naturschutzprojekt in Madang an der Nordküste von Papua-Neuguinea war beendet, oder sagen wir besser, es machte keinen Sinn mehr, dort zu arbeiten, da die Forschungsstation, wo ich beschäftigt war, wegen finanziellen Missmanagements von den Gebern aus Übersee geschlossen worden war. Ich hatte dann in Zusammenarbeit mit der Tourismusbehörde der Provinz begonnen, die Dörfer in Öko-Tourismus zu beraten, einen Naturlehrpfad im Regenwald angelegt und mehrere kleine Gästehäuser aufgebaut. Auf Wunsch der Leute begann ich außerdem, die lokalen Mythen und Sagen aufzuschreiben, was für die Einheimischen wichtig war als Gegengewicht zu den überall gegenwärtigen Missionaren.
Letztlich aber hatte mich Raimund, mein Chef, in die Hauptstadt geholt. Ich sollte die letzten Monate bis zum Vertragsende helfen, ein paar Broschüren und ein Lehrbuch für das Berufsschulprojekt fertigzustellen.
Zuerst wohnte ich im Gästehaus unserer Organisation im Zentrum von Port Moresby, doch war ich öfter bei Raimund zu Gast, der auf einem Hügel über der Stadt eine große Villa gemietet hatte. Seine Frau Ricarda war Malerin und förderte eine Gruppe von einheimischen Künstlerinnen und stellte ihnen Farben und Leinwände zur Verfügung. Im obersten Geschoss des Hauses waren zwei weite Räume als Ateliers eingerichtet. Ursprünglich hatte sie einmal pro Woche zu einem Maltag eingeladen, doch einige der Frauen kamen fast täglich, um an ihren Werken zu arbeiten.
Gleich nach meiner Ankunft in der Hauptstadt hatte ich ihr geholfen, eine Ausstellung für ihre Künstlerinnen vorzubereiten, die im Chaos zu enden drohte. Zwar waren die Bilder alle pünktlich abgegeben worden, doch der Tischler, der die maßgerechten Rahmen anfertigen sollte, wurde nicht fertig. Folglich konnten die Gemälde und Grafiken nicht aufgehängt und die Beleuchtung nicht angepasst werden. Es mangelte an starker Angelsehne zum Aufhängen, an Werkzeug, an Handwerkern, an Dekoration, an Reinigungskräften und vor allem an jemandem, der das rechtzeitig besorgte und kontrollierte. Sechs Tage vor der geplanten Eröffnung rief mich Raimund in sein Büro und fragte, ob ich nicht das Kommando übernehmen könnte, denn seine Frau war Künstlerin, aber keine Managerin und dem Nervenzusammenbruch nahe. Ich konnte und kommandierte eine halbe Stunde später ein ganzes Heer von Arbeitern.
Um es kurz zu machen - wir schafften es. Während draußen schon die Presse und das Fernsehen anrollten, schob ich drinnen noch die Blumendekoration zurecht. Ricarda strahlte bereits in die Fernsehkameras und gab ein glänzendes Interview. Die Ausstellung wurde ein großer Erfolg. Später war ich deshalb immer ein willkommener Gast in Raimunds Haus und vor allem bei Ricarda und den Künstlerinnen.
Ich besuchte sie gern, denn die Villa bot von den Balkons einen eindrucksvollen Blick über die Stadt und die Meeresbucht. Außerdem wehte hier, im Gegensatz zu dem stickigen Tal, wo das Gästehaus stand, stets ein frischer Wind vom Meer. Nichts war angenehmer, als nach einem heißen Tag, und die Tage waren alle heiß, mit einem kalten Bier in einem der Liegestühle den Tag ausklingen zu lassen.
Hier lernte ich Nora kennen. Sie war eine von den Malerinnen, die fast jeden Tag ins Atelier kamen. Ich liebte die Atmosphäre dort oben. Die Frauen hatten immer einen Scherz auf den Lippen, während sie an ihren Bildern arbeiteten und ich hatte stets ein Sixpack im Rucksack.
So wäre es vermutlich noch ein paar Monate weitergegangen, wenn mir nicht die Jüngste von den dreien, Nora, so schrecklich gut gefallen hätte. Die beiden anderen merkten selbstverständlich, dass ich fast jeden Abend im Atelier war und ein ausgesprochenes Interesse für die Werke der Jüngsten von ihnen zeigte.
Nora war Ende zwanzig und dabei schlank und kindlich. Ihr Gesicht war fein geschnitten, wie bei den Menschen von den südlichen Inseln. Während die eine Malerin aus dem Sepiktal kam und die typische kräftige Statur mit männlichen Gesichtszügen und dicker Nase hatte, war die zweite eine untersetzte Chimbu aus dem Hochland. Beide hatten breite Schultern und noch breitere Hüften. Neben den zweien wirkte Nora fast filigran und wie von einem Künstler aus dunklem Holz geschnitzt.
Fasziniert war ich von Noras Augen, die sehr groß waren und mich leider viel zu selten anblickten. Wie die meisten Menschen hier, sah auch sie mir aus Höflichkeit nie in die Augen, sondern blickte selbst im direkten Gespräch irgendwo ins Unbestimmte hinter mir. Am Anfang hatte mich das irritiert. Ich glaubte, die Leute redeten mit jemand anderem, der hinter mir steht. Doch entsprechend ihrer Tradition wäre es aufdringlich gewesen, einem Gesprächspartner direkt in die Augen zu schauen.
Unser Verhältnis, was ja gar keins war, änderte sich schlagartig, als mich Nora eines Tages voll ansah und ich das Gefühl hatte, in diesen dunklen Rehaugen zu ertrinken. Ich war wie im Taumel, als sie eine Weile später den Raum verließ und die beiden anderen mich warnten. Sie wäre eine Hexe.
Sie hatte mich wirklich mit einem einzigen Blick verhext. Von nun an wartete ich nur auf sie und versuchte immer wieder, einen derartigen Blick von ihr aufzufangen. Auf die Warnung gab ich selbstredend keinen Pfifferling.
Auch damals war es ein Abendhimmel gewesen, vor dem ich mit Nora auf der Terrasse des Ateliers stand und ihre Hand fasste und sie vorsichtig an mich zog. Sie hatte einen weichen, geschmeidigen Körper und schien noch während unseres Kusses über etwas nachzudenken. Dann sagte sie:
„Du weißt doch, worauf du dich einlässt? Ich bin eine Hexe.“
...
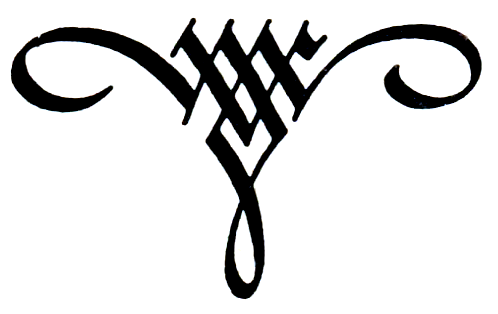
Der Roman wurde bei Amazon veröffentlicht und kann hier erworben werden.